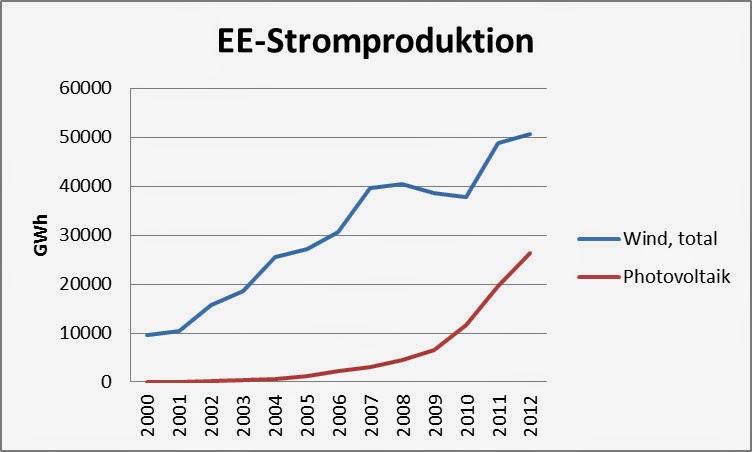Alle Jahre wieder sorgt der Global Competitiveness Report (GCR) für Schlagzeilen. Das diesjährige Ranking ist
hier im Internet zu finden. Die Ergebnisse des Vorjahres sind
hier zusammengestellt.
Nun, Rankings sind populär, und ganz nebenbei auch eine gute Einnahmequelle für manche Thinktanks. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit, die ihnen entgegen gebracht wird.
Es liegt nunmal in der menschlichen Natur, sich mit anderen zu vergleichen. Im Sport ist die Sache relativ einfach: Man lässt Teams oder Einzelsportler gegeneinander antreten, und am Ende des Wettbewerbs hat man einen klaren Sieger. Sofern alles mit rechten Dingen zugegangen ist. In vielen Sportarten gibt es eine Weltrangliste, die üblicherweise etwas stabiler ist als die Ergebnisse einzelner Wettkämpfe.
Viel schwieriger ist es, relativ abstrakte Kriterien zu messen, wie etwa Lebensqualität, Wettbewerbsfähigkeit und andere Dinge. Gleichwohl ist es wünschenswert und bis zu einem gewissen Grad wohl auch notwendig, solche Dinge zu messen. Denn es versteht sich von selbst, dass bestimmte Länder, etwa Österreich und Venezuela, unterschiedlich wettbewerbsfähig sind. Man hätte aber gerne einen Maßstab für diese Verschiedenheit, und der GCR sorgt mit einem Punktesystem dafür, diese Unterschiedlichkeit deutlich zu machen.
Nun steht es mir nicht an, die Methodik des Welwirtschaftsforums (ich halte mich hier an die internationale Abkürzung WEF) zu kritisieren oder gar abzulehnen. Ein ganzes Paket von Faktoren fließt in die Berechnung der Gesamtpunktezahl ein. Dazu gehören Dinge wie: Infrastruktur, Gesundheitswesen, Bildung, Innovation, Effizienz des Arbeitsmarkts etc.
Bei allem Detailreichtum und der unterstellten Sauberkeit der Methodik, die hier nicht in Zweifel gezogen wird, sind dennoch ein paar Worte der Vorsicht angebracht. Bei jedem komplexen Verfahren gibt es eine Reihe von Faktoren, die zwar entscheidend in das Gesamtergebnis einfließen, aber im Endresultat nicht mehr als solche zu erkennen sind. Es ist wie bei einem Kuchen, wo man aus dem essfertigen Stück keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Zutaten und deren Menge machen kann. Dass Eier drin sind, ist klar. Aber wie viele waren es denn?
Fest steht jedenfalls, dass man aus denselben Faktoren mit einer anderen Gewichtung ein anderes Resultat und vielleicht auch ein anderes Ranking bekommen hätte. Und wer sagt einem, dass gerade diese Gewichtung die optimale ist? Üblicherweise werden diese Verfahren auf ihre Robustheit getestet, um die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse einigermaßen sicherzustellen. Es wäre ja auch wirklich erstaunlich, wenn sich Schweden plötzlich hinter Burkina Faso befände.
Es gibt auch noch ein anderes Merkmal, das zur Vorsicht rät. Sowohl sämtliche Parameter als auch das Endergebnis werden auf einer Punkteskala von 1 bis 7 (Bestnote) abgebildet. Das hat zwangsläufig zur Folge, dass bei mehr als 140 miteinander verglichenen Staaten den Nachkommstellen eine entscheidende Rolle zukommt. Klar ist 7 besser als 6 und 6 besser als 5. Aber ist 5,42 wirklich spürbar besser als 5,41? Und es sind gerade solche Unterschiede, die ausschlaggebend sind und das Ranking verändern können.
Sehr wir uns ein paar Beispiele an. Ich liste die 10 wettbewerbsfähigsten und einige ausgewählte Länder des jüngsten GCR auf (in Klammern ist die jeweilige Punktezahl aufgeführt). Hinter dem Ländernamen ist das Ranking und die Punktezahl des Vorjahres angegeben:
1 (5,70) Schweiz 1 (5,67)
2 (5,65) Singapur 2 (5,61)
3 (5,54) USA 5 (5,48)
4 (5,50) Finnland 3 (5,54)
5 (5,49) Deutschland 4 (5,51)
6 (5,47) Japan 9 (5,40)
7 (5,46) Hongkong 7 (5,47)
8 (5,45) Niederlande 8 (5,42)
9 (5,41) Vereinigtes Königreich 10 (5,37)
10 (5,41) Schweden 6 (5,48)
21 (5,16) Österreich 16 (5,15)
36 (4,54) Portugal 51 (4,40)
81 (4,04) Griechenland 91 (3,93)
Es ist wie beim Skilaufen. Ein paar hunderstel Sekunden entscheiden über die Platzierung, aber die Top 10 sind allesamt ausgezeichnete Skifahrer.
Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass Veränderungen in der 2. Dezimale, also im Hundertstel-Bereich als nicht signifikant anzusehen sind. Aussagekräftiges wird erst ab Veränderungen in der 1. Dezimale produziert. Dann können wir die Veränderungen im Ranking der Top 10 mit einiger Berechtigung als Kinkerlitzchen bezeichnen.
Österreich ist, absolut gesehen, praktisch unverändert geblieben. Angesichts dieser Faktenlage ist es wohl ein wenig übertrieben, wenn die
Presse hinausposaunt, Österreichs Wirtschaft verliere an Wettbewerbsfähigkeit. Das klingt schon fast nach Absturz. Zwischen Schweden auf dem 10. Platz und Österreich auf dem 21. liegen nur 0,25 Punkte. Der absolute Unterschied zwischen den Positionen 1 und 10 beträgt hingegen 0,29 Punkte, also grob gesprochen drei Zehntel. Viel deutlicher ist der Abstand in Punkten zwischen Österreich und Portugal (0,62) bzw. Griechenland (1,37), bestimmt keine Vorbilder für die Alpenrepublik, aber auch auf mittlere Sicht keine unmittelbaren Konkurrenten. Hier bewegen wir uns in einer Gegend, wo die Unterschiede spürbar werden.
Es stimmt schon, Österreich ist im Ranking abgerutscht, aber nicht weil es "schlechter" geworden ist, sondern weil andere aufgeholt haben. Wir aollten also die Kirche im Dorf lassen. Es gibt keinen Grund zur Panik. Das soll nicht heißen, dass wir uns gemütlich zurücklehnen sollen. Es gibt vieles zu verbessern. Und bei näherer Betrachtung ist es geradezu ein Wunder, dass das Land angesichts der seit Jahren andauernden politischen Lähmung immer noch so gut drauf ist.
Rankings sind nützlich und interessant, aber wir sollten ihre Beschränktheiten nicht übersehen.